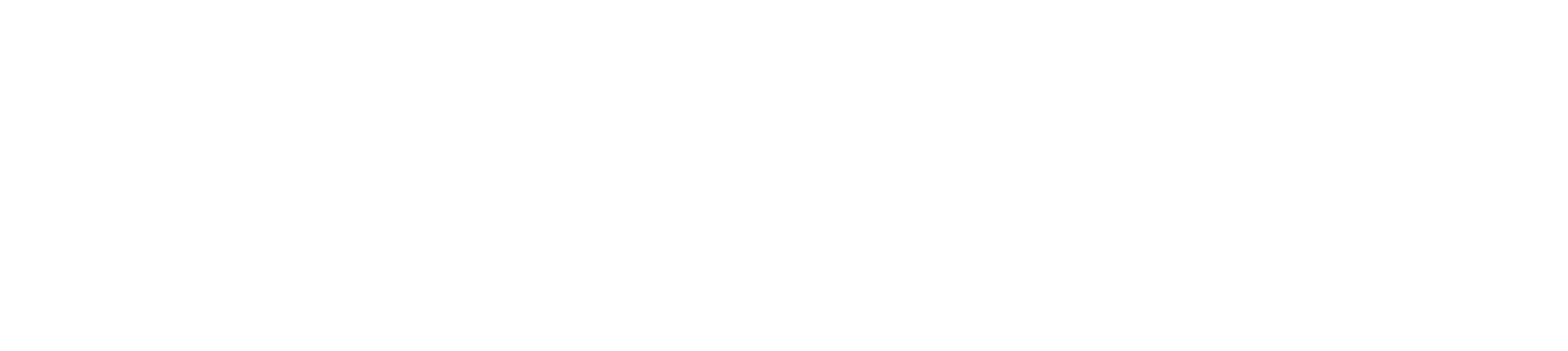Sie haben einen Komposter in Ihrem Garten oder in Ihrer Küche aufgestellt, und seitdem beschäftigt Sie bei jeder Mahlzeit eine neue Frage: „Kann ich das in den Kompost geben?“ Avocadoschalen, Eierschalen, Melonenreste, Teebeutel, Papierservietten, Käserinde … Die Fragen sind zahlreich und die Antworten nicht immer eindeutig.
Denn Kompostieren bedeutet nicht nur, den Küchenabfallbehälter in einer Ecke des Gartens zu leeren. Um richtig zu kompostieren, muss man verstehen, wie der Prozess funktioniert und vor allem, was die Mikroorganismen, die Ihren Abfall in Humus umwandeln, brauchen – oder vermeiden. Ein guter Kompost basiert auf einem gewissen Gleichgewicht. Und während sich manche organische Abfälle problemlos integrieren lassen, können andere die Zersetzung verlangsamen, den Prozess stören oder sogar Schäden verursachen.
Dieser Artikel soll Ihnen helfen, sich ohne Fachjargon und Moralpredigten einen Überblick zu verschaffen. Hier finden Sie:
- Die wichtigsten Grundsätze zum Verständnis der Vorgänge in einem Komposter (Version für Laien und Experten)
- Was man hineinwerfen kann und warum
- Was man besser vermeiden sollte und aus welchen Gründen
- Eine vollständige Liste der wichtigsten Alltagsabfälle in alphabetischer Reihenfolge mit einer klaren Antwort: kompostierbar oder nicht?
Ob Sie nun Anfänger oder bereits erfahrener Kompostierer sind, dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Ihre Praktiken zu verbessern – oder einfach nur, sich nicht mehr jedes Mal zu fragen, wenn Sie eine Karotte schälen, wie Sie diese entsorgen sollen.
Teil 1:
Was macht einen guten Kompost aus?
Warum ist nicht alles kompostierbar?
Die Kompostierung basiert auf einem bewährten biologischen Prozess: der Zersetzung organischer Stoffe durch Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und Makroorganismen (Regenwürmer, Insekten, Asseln usw.). Diese Lebewesen wandeln Ihre Abfälle nach und nach in Humus um, einen reichhaltigen und stabilen Stoff, der wieder in den Boden zurückgeführt werden kann, um dort Leben zu nähren. Dieser Prozess funktioniert jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Und nicht alle Abfälle erfüllen diese Bedingungen.
Drei wichtige Faktoren beeinflussen die Qualität eines Komposts:
- Das Gleichgewicht zwischen Kohlenstoff und Stickstoff
- Die Belüftung des Komposts
- Die Feuchtigkeit
Ein Ungleichgewicht in einem dieser drei Bereiche kann den Abbau verlangsamen, schlechte Gerüche verursachen oder den Kompost sogar unbrauchbar machen.

Das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff: der Schlüssel zu einem ausgewogenen Kompost
Man spricht oft von „trockenen“ und „feuchten“ Abfällen oder von „braunen“ und „grünen“ Abfällen. Hinter diesen Begriffen verbirgt sich ein grundlegendes Verhältnis in der Kompostierung: das C/N-Verhältnis, d. h. das Verhältnis zwischen dem Kohlenstoff (C) und dem Stickstoff (N) in den kompostierten Stoffen.
- Kohlenstoff ist der Energieträger von Mikroorganismen. Er kommt in trockenen Materialien vor: Laub, zerkleinerte Äste, unbehandeltes Papier, brauner Karton, Sägemehl…
- Stickstoff beschleunigt das Wachstum von Mikroorganismen. Er ist vor allem in feuchten und nährstoffreichen Materialien enthalten: Schalen, Speisereste, Rasenschnitt, Kaffeesatz…
Damit Kompost gut funktioniert, benötigt er ein C/N-Verhältnis zwischen 25:1 und 30:1. Das bedeutet, dass viel mehr Kohlenstoff als Stickstoff vorhanden sein muss. Ist dieses Verhältnis unausgewogen,
- Zu viel Stickstoff? Der Kompost wird zu feucht, riecht nach Ammoniak oder Fäulnis, die Gärung überwiegt gegenüber der Zersetzung.
- Zu viel Kohlenstoff? Der Kompost trocknet aus, verlangsamt sich und den Mikroorganismen fehlen Nährstoffe für ihre Entwicklung.
Zu beachten: Wenn Ihr Kompost zu feucht ist, fügen Sie braunes Material (Laub, Karton) hinzu. Wenn er zu trocken ist oder sich zu langsam zersetzt, fügen Sie frisches Material hinzu.
Belüftung: Kompost braucht Sauerstoff
Die Kompostierung im Haushalt ist ein aerobischer Prozess, d. h. sie benötigt Sauerstoff, um richtig zu funktionieren. In Abwesenheit von Luft übernehmen andere Mikroorganismen, sogenannte anaerobe Mikroorganismen, diese Aufgabe… aber ihre Aktivität erzeugt Methan, Gärgerüche und verlangsamt die Zersetzung.
Eine gute Belüftung ermöglicht:
- Vermeidung von schlechten Gerüchen
- Aktivierung der Materialumwandlung
- Vermeidung von Saftbildung oder verdichteten Stellen
Konkret bedeutet dies, dass Folgendes erforderlich ist:
- Regelmäßiges Umschichten des Komposts (alle 10 bis 15 Tage)
- Nicht überladen mit sehr feuchten Abfällen oder dicken Schichten (z. B. frischer Rasen)
- Braune und grüne Schichten abwechseln, um eine luftige Struktur zu fördern
Wie reguliert man die Feuchtigkeit seines Komposts?
Feuchtigkeit ist unverzichtbar: Mikroorganismen arbeiten in einer feuchten Umgebung, nicht in einer trockenen. Zu viel Wasser kann jedoch die Luft verdrängen und ein anaerobes Milieu schaffen. Das Ziel ist es, eine Feuchtigkeit zu erhalten, die mit der eines ausgewrungenen Schwamms vergleichbar ist. Zu trockener Kompost verrottet nicht. Zu feuchter Kompost riecht schlecht.
Häufige Ursachen für übermäßige Feuchtigkeit:
- Zu viel Obst, Gemüse oder gekochte Lebensmittel werden ohne Zugabe von Trockenstoffen entsorgt
- Fehlen von braunen, saugfähigen Materialien (Papier, Karton, Blätter)
- Schlecht konstruierter Deckel des Komposters (schlechte Wasserableitung)
Gute Idee: Denken Sie daran, bei jeder Zugabe von frischem Material etwas Braunes hinzuzufügen. Wenn Sie eine Schüssel mit Schalenresten leeren, geben Sie eine Handvoll Pappe oder Laubblätter darüber.
Welche Abfälle können beim Kompostieren Probleme verursachen?
Nicht alle organischen Abfälle sind für die Kompostierung gleich geeignet. Einige sind zu fett, zu sauer, zerfallen zu langsam oder bergen Gesundheitsrisiken.
Einige Beispiele:
- Fleisch, Fisch, Milchprodukte: Sie sind reich an tierischen Fetten und Proteinen, ziehen Schädlinge an und zersetzen sich bei Raumtemperatur nur schlecht.
- Zitrusfrüchte, Knoblauch, Zwiebeln: Sie sind sehr säurehaltig oder antibakteriell und können die Arbeit von Mikroorganismen hemmen.
- Kranke Pflanzen: Sie können ihre Krankheitserreger in den Kompost übertragen.
- Bedrucktes oder gebleichtes Papier: Enthält Druckfarben, Klebstoffe oder chemische Behandlungsmittel.
In einer industriellen Kompostierungsanlage, in der hohe Temperaturen (bis zu 70 °C) herrschen, können diese Abfälle verarbeitet werden. In einer häuslichen Kompostierung ist jedoch Vorsicht geboten.
Die Version für Experten
Tauchen Sie ein in die Welt des Komposts: Hinter den Kulissen eines mikrobiellen Festmahls
Bevor wir uns damit befassen, was man in einen Kompost geben kann und was nicht, muss man eines verstehen: Kompost ist kein Mülleimer, sondern ein lebendiges Ökosystem, ein wahres Festmahl unter freiem Himmel … für Milliarden kleiner, unsichtbarer Münder. Und zu diesem Festmahl sind sehr viele Gäste geladen: Bakterien, Pilze, Actinobakterien, Collembolen, Würmer, Milben, Nematoden usw. Aber beginnen wir mit den Küchenchefs dieses großen Buffets: den Mikroorganismen.
Mikroorganismen, die unsichtbaren Arbeiter des Komposts
Bakterien: die ersten am Tisch
Sie sind die Stars der Kompostierung. Sobald neue organische Abfälle hinzukommen, tauchen sie in großer Zahl auf. Je nach der Temperatur, die sie bevorzugen, lassen sich drei große Bakterienkategorien unterscheiden:
- Mesophile: Sie entwickeln sich bei Temperaturen zwischen 10 und 40 °C. Sie sind die ersten, die aktiv werden. Sobald Sie Schalen oder Kaffeesatz in den Behälter geben, beginnen sie mit der Zersetzung.
- Thermophile: Sie übernehmen, wenn sich der Kompost erwärmt, in der Regel zwischen 40 und 70 °C. Sie beschleunigen den Abbau der zähesten Stoffe wie Zellulose aus Papier oder Pflanzenfasern. Im Hauskompost sind sie vor allem im Sommer oder in ausgewogenen Mengen aktiv.
- Actinobakterien: Diese etwas besonderen Bakterien lieben trockene und holzige Materialien. Sie zersetzen kohlenstoffreiche Materialien (wie Laub oder Pappe). Oft sind sie es, die dem reifen Kompost seinen angenehmen Duft nach Unterholz verleihen.
Pilze: geduldige Zersetzer
Im Gegensatz zu Bakterien haben Pilze es weniger eilig: Sie entwickeln sich unter trockeneren und saureren Bedingungen. Ihre Spezialität? Komplexe Strukturen wie Lignin oder Zellulose (die in Holz, braunem Papier oder bestimmten
Pflanzenfasern vorkommen) abzubauen. Wenn Sie weiße Fäden in Ihrem Kompost sehen, sind das oft Pilze.
Sie sind wie akribische Handwerker, die ein Holzmöbelstück zerlegen, um jede Schraube wiederzufinden. Langsam, aber äußerst effizient.
Und die anderen?
Regenwürmer, Springschwänze, Asseln oder Larven von Goldhähnchen sind ebenfalls mit von der Partie, vor allem in der Reifephase. Sie durchmischen, zerkauen, verdauen … und verwandeln alles in Humus. Man nennt sie Makroorganismen.
Woher kommen diese Bakterien und Pilze?
Das ist eine der schönsten Lektionen, die uns der Kompost lehrt: Nichts ist jemals völlig steril. Mikroorganismen sind überall um uns herum. Sie gelangen in Ihren Kompost:
- Über die Abfälle selbst (Obst, Gemüse, Kaffeesatz, Eierschalen … all diese Abfälle tragen bereits Bakterien auf ihrer Oberfläche)
- Über den Boden (wenn Ihr Komposter Kontakt zum Boden hat, haben Würmer und Bakterien freien Zugang)
- Über die Luft (Pilzsporen und Bakterien fliegen durch die Luft und setzen sich auf natürliche Weise ab)
Mit anderen Worten: Sie müssen keinen Kompost „besäen”, damit er funktioniert. Er bevölkert sich von selbst, vorausgesetzt, Sie bieten ihm eine günstige Umgebung.
Stickstoff und Kohlenstoff: Treibstoff und Struktur
In vielen Ratgebern ist von „grünen“ und „braunen“ Materialien die Rede, doch der eigentliche Unterschied liegt in ihrem Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt.
Hier eine einfache Metapher: Stellen Sie sich Kompost als eine große Grillparty vor.
- Kohlenstoff (C) ist die Kohle, der Brennstoff, der das Feuer nährt.
- Stickstoff (N) ist das Fleisch, das Sie auf den Grill legen: Das ist es, was die Mikroben essen wollen.
Aber Vorsicht: Ohne Kohle brennt das Feuer nicht. Und ohne Fleisch ist es nutzlos. Es muss also ein gutes Gleichgewicht zwischen beiden bestehen.
Konkrete Beispiele:
- Eine Bananenschale: reich an Stickstoff → „grüner“ Stoff
- Ein abgestorbenes Blatt: reich an Kohlenstoff → „brauner“ Stoff
- Ein Stück zerrissener Karton: sehr kohlenstoffhaltig
- Kaffeesatz: trotz seiner Farbe sehr stickstoffhaltig
- Trockenes Brot: dazwischen, aber eher kohlenstoffhaltig (vor allem wenn es hart ist)
Zu beachten:
➤ Mikroorganismen ernähren sich von Stickstoff…
➤ …aber sie benötigen Kohlenstoff als Energiequelle, um dies zu tun.

Warum verhalten sich manche Lebensmittel anders als andere?
Beobachten Sie Ihre Essensreste. Ein Stück Brot wird trocken und hart, wenn es einige Tage auf dem Tisch liegt. Eine Banane hingegen wird weich, schwarz und riecht nach Gärung. Fleischreste riechen sehr unangenehm. Warum?
Das hängt mit der Struktur und der Zusammensetzung zusammen:
- Brot ist trocken, fettarm und reich an Stärke → es verliert Feuchtigkeit und wird hart
- Bananen sind reich an Zucker → Bakterien lieben das, die Zellen platzen, sie „schmelzen“
- Fleisch ist reich an Proteinen → es zieht bestimmte Bakterien (oft anaerobe) an, die stark riechende Schwefelverbindungen produzieren
Stickstoffreiche Lebensmittel (Eiweiß, Zucker, tierische Stoffe) verrotten am schnellsten. Trockene und ballaststoffreiche Lebensmittel (Papier, Blätter, Brot, Karton) zersetzen sich langsamer oder gar nicht, wenn sie zu trocken oder verdichtet sind.
Welche Risiken birgt ein unausgewogener Kompost?
Wenn Sie alle Ihre Lebensmittelreste ohne Zugabe von Trockenmaterial entsorgen, entsteht ein zu stickstoffreiches und zu feuchtes Milieu. Das Ergebnis:
- Aerobe Mikroorganismen ersticken
- Anaerobe Bakterien übernehmen
- Das Ergebnis: Es gärt, es riecht schlecht, es wird klebrig und es zieht Fliegen an.
Umgekehrt wird Ihr Kompost, wenn Sie nur Karton oder Laub verwenden, wie folgt aussehen:
- Zu trocken
- Langsamer Start
- Unattraktiv für Bakterien
- Ergebnis: Es stagniert, es bröckelt und es passiert nichts.
|
Element |
Rolle im Kompost |
Allgemeines Beispiel |
| Kohlenstoff (C) |
Energie / Struktur |
Karton, Papier, Laub |
|
Stickstoff (N) |
Nährstoffe für Mikroben |
Schalen, Kaffeesatz |
|
Mesophile Bakterien |
Erste Abbauprodukte |
Obst, frisches Gemüse |
|
Thermophile Bakterien |
Hochtemperaturbeschleuniger |
Gut angelegter Kompost |
|
Actinobacteria |
Zersetzen Holz und Papier |
Karton, Zweige |
|
Pilze |
Sekundäre Zersetzer |
Holz, Papier, harte Pflanzen |
Teil 2:
Was kann man in den Kompost geben (und was nicht)?
Industrieller oder häuslicher Kompost: Was ist der Unterschied?
Zunächst einmal eine wichtige Erinnerung: Nicht alles, was „kompostierbar“ ist, kann auch bei Ihnen zu Hause kompostiert werden.
Es gibt zwei Haupttypen von Kompostern:
Haushaltskomposter
- Gartenkomposter
- Wurmkomposter
- Wohnungskomposter mit oder ohne Bokashi
Variable Temperatur (15 bis 50 °C), geringes Volumen, kein anhaltender Temperaturanstieg
Empfindlicher, anfällig für Feuchtigkeit, Sortierfehler und Schädlinge
Industrielle Komposter
- Behandlung von Bioabfällen bei hohen Temperaturen (bis zu 70 °C)
- Schneller Abbau, Vernichtung von Krankheitserregern, Akzeptanz bestimmter kompostierbarer Verpackungen
Die Anweisungen sind nicht dieselben. Eine „kompostierbare“ Verpackung in einem industriellen Kompost kann sich in einem Hauskompost möglicherweise nie zersetzen.
Kompostierbarkeit: Welche großen Abfallgruppen gibt es?
Rohe Pflanzenabfälle: die grundlegenden Verbündeten
Organische Abfälle pflanzlichen Ursprungs sind aus der Kompostierung im Haushalt nicht wegzudenken. Sie sind einfach zu handhaben, bekannt und effizient und bilden die ideale Grundlage für einen gesunden und ausgewogenen Kompost.

Dazu gehören insbesondere:
- Gemüseschalen
- Beschädigte Früchte
- Kaffeesatz
- Teebeutel (ohne Klammern und Plastik)
- Eierschalen (wenn möglich zerkleinert)
- Abgefallene Blätter
- Verwelkte Blumen
- Stiele und Blätter (Karotten, Radieschen, Lauch…)
Tipp: Bei dicken oder faserigen Stielen (z. B. Lauch) zerkleinern. Zitrusschalen sind kompostierbar, jedoch nur in kleinen Mengen, da sie säurehaltig sind und sich nur langsam zersetzen.
Warum muss mit rohen Lebensmittelabfällen vorsichtig umgegangen werden?
Dies ist ein Punkt, bei dem viele Menschen einen Fehler machen. Entgegen der landläufigen Meinung können bestimmte gekochte Lebensmittel unter strengen Auflagen tatsächlich dem Kompost zugeführt werden. Geeignet sind jedoch nur vegetarische, fettarme und saucenfreie Speisereste. Gerichte mit Käse, Fleisch, übermäßigem Fettgehalt oder zu salzigen oder zu süßen Gewürzen sind unbedingt zu vermeiden, da sie das Gleichgewicht des Komposts stören und Schädlinge anziehen. Reste wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln, trockenes Brot, gedünstetes Gemüse oder Pizzakrusten ohne Käse sind für den Hauskompost völlig unbedenklich.
Reichhaltige oder verarbeitete Speisen wie Lasagne, Quiche, Aufläufe oder Cremesuppen sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Diese zu fettigen und zu salzigen Lebensmittel verlangsamen die Zersetzung, verursachen schlechte Gerüche, gären schnell und ziehen Schädlinge wie Fliegen oder Nagetiere an.
Tipp: Vergraben Sie diese gekochten Reste in der Mitte des Komposts und fügen Sie sofort braunes Material (Laub, Karton) hinzu.
Warum sollte man tierische Abfälle vermeiden?
Sie sind reich an Proteinen und Fetten, daher attraktiv für Nagetiere, Fliegen … und besonders schwer kalt zu kompostieren.
- Rohes oder gekochtes Fleisch
- Fisch, Krustentiere, Schalentiere
- Milchprodukte (Butter, Käse, Joghurt)
- Ganze oder aufgeschlagene Eier
- Fette, Saucen, Speiseöle
Allerdings sind einige Ausnahmen möglich, wie z. B. (zerkleinerte) Eierschalen und kleine Milchproduktreste in einem gut funktionierenden oder industriellen Komposter.
In der Hauskompostierung zerfallen diese Abfälle nicht gut und stellen ein Gesundheitsrisiko dar.
Warum sind Papier und Karton für Ihren Kompost so wichtig?
Trockene Stoffe sind unverzichtbar, um den Feuchtigkeitsgehalt auszugleichen. Sie nehmen Feuchtigkeit auf, fördern die Belüftung und dienen den Actinobakterien als Nahrung. Es wird empfohlen, folgende Stoffe zu bevorzugen:
- Gebrauchte Küchentücher (nicht parfümiert)
- Papiertaschentücher
- Eierkartons
- Zeitungen in kleinen Mengen
- Ungedruckter brauner Karton
- Kraftpapier
Bestimmte Inhaltsstoffe sollten jedoch vermieden werden, darunter:
- Glänzendes, laminiertes, gebleichtes Papier
- Duftende, farbige Servietten
- Mit chemischen Tinten bedruckte Verpackungen
Tipp: In kleine Stücke zerreißen, um den Abbau zu beschleunigen.
Biokunststoffe, „kompostierbare“ Papiere, Mikroplastik: Vorsicht vor falschen guten Ideen
Die zunehmende Verbreitung von Verpackungen, die als „kompostierbar“ oder „biobasiert“ bezeichnet werden, sorgt oft für Verwirrung. Pappbecher, Kraftpapiertüten, Salatschalen oder „Bio“-Teebeutel versprechen „Umweltfreundlichkeit“ … aber nicht alle sind in einem Hauskompost willkommen.
„Undurchlässiges” Papier und Karton
Viele „Kartonverpackungen” sind in Wirklichkeit mit einer dünnen Kunststofffolie (Polyethylen, Polypropylen usw.) überzogen, um sie feuchtigkeitsundurchlässig zu machen. Dies ist beispielsweise der Fall bei:
- Becher für Heißgetränke
- Lebensmittelschalen
- Fast-Food-Behälter
- Bestimmte Teebeutel oder Kräutertees
Diese Folien zerfallen jedoch nicht in einem Gartenkomposter. Sie können in Mikroplastik zerfallen und den fertigen Kompost verschmutzen.
Biokunststoffe: Was sind sie wirklich wert?
Biokunststoffe sind Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen (Maisstärke, Zuckerrohr usw.), die manchmal nach der Norm EN 13432 als kompostierbar zertifiziert sind.
Aber Vorsicht:
- Diese Norm gilt für die industrielle Kompostierung bei hohen Temperaturen und starker Durchmischung
- In einem Komposter für den Hausgebrauch werden diese Materialien schlecht, langsam oder gar nicht abgebaut
- Das Ergebnis: Sie bleiben lange sichtbar oder zerfallen, ohne wirklich zersetzt zu werden
Mikroplastik: Warum abgebaut nicht gleich verdaut bedeutet
Bestimmte Materialien zerfallen unter dem Einfluss von Hitze oder Feuchtigkeit, werden jedoch nicht von Mikroorganismen zersetzt. Sie werden zu Mikroplastik, das zwar unsichtbar, aber langlebig ist. Diese Rückstände können Ihren Kompost und damit Ihre Pflanzen und letztendlich auch den Boden und die Nahrungskette verunreinigen. Die ökologischen Auswirkungen sind noch nicht genau bekannt, daher ist Vorsicht geboten.
Was Sie bedenkenlos kompostieren können
|
Verpackungsart
|
Haushaltskompost?
|
Warum?
|
|
Teebeutel mit Clipverschluss
|
Nein |
Metall + Kunststoff |
|
Teebeutel aus ungebleichtem Papier |
Ja |
Biologisch abbaubar und |
|
Kaffeebecher aus Karton |
Nein |
Kunststofffolie |
|
Burgerbox „Kraft“ |
Achtung |
Zu überprüfen: oft mit Folie überzogen |
|
Unbehandelte, fettfreie Kraftpapiertüte |
Ja |
Gute Kohlenstoffquelle |
|
Kompostierbare Beutel EN 13432 |
Nein |
Nur industrieller Kompost |
|
OK compost HOME-Beutel |
Achtung |
Zu testen, aber manchmal enttäuschend |
| Film auf Stärkebasis (Mais, Maniok…) | Achtung |
Zersetzt sich langsam, wird nicht immer verdaut |
Pflanzen, Blätter und Blüten: Warum muss man auf Ausnahmen achten?

Bei der Kompostierung ist es vorteilhaft, folgende Pflanzen zu verwenden:
- Laub
- Gartenabfälle
- Verwelkte Pflanzen
- Blumen aus dem Strauß
Folgende Elemente sollten jedoch vermieden werden:
- Kranke oder befallene Pflanzen (Risiko der Verbreitung von Krankheitserregern)
- Dicke oder wachsartige Blätter (z. B. Lorbeer, Eiche): sehr langsamer Abbau
- Mit Pestiziden behandelte Pflanzen
Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie die Pflanzen einige Tage trocknen, bevor Sie sie kompostieren.
Es gibt jedoch Sonderfälle:
|
Element
|
Kompostierbar?
|
Anmerkungen
|
|
Zitrusfrüchte |
Ja, in Maßen |
Zu viel Säure |
|
Zwiebeln, Knoblauch |
Ja |
Antibakterielle Mittel → einschränken |
|
Avocadoschalen, Kerne |
Nein, oder sehr langsam |
Zu zäh |
|
Fruchtkerne |
Nein, oder sehr langsam |
Kann 2 bis 5 Jahre dauern |
|
Holzasche |
In kleinen Dosen |
Sehr alkalisch |
|
Holzspäne |
Ja |
Wenn nicht behandelt |
|
Sukkulenten (Aloe-Art) |
Mit Vorsicht |
Sehr feucht, langsame Zersetzung |
|
Frittieröl |
Nein |
Erstickt Mikroorganismen |
|
Naturtextilien |
Achtung |
Sehr langsam, muss zerschnitten werden |
Teil 3:
Alphabetische Liste: Was kann man wirklich in den Kompost geben?
Diese Liste ist für alle, die schon einmal vor ihrem Mülleimer standen und sich gefragt haben:
„Kann ich das in den Kompost werfen?“
| Abfallart in alphabetischer Reihenfolge |
Kompostierbar? |
Anmerkungen |
|
Zitrusfrüchte |
In Maßen |
Säurehaltig, langsamer Abbau |
|
Knoblauch |
Ja |
Antibakterielle Wirkung, Menge begrenzen |
|
Ananas |
Ja |
Säurehaltig, faserig, aber kompostierbar |
|
Avocado (Schale, Kern) |
Nein, sehr langsam |
Sehr widerstandsfähig, braucht Jahre, um sich zu zersetzen |
|
Sehr reife Bananen |
Ja |
Perfekt, um einen Abbau in Gang zu bringen |
|
Banane |
Ja |
Weicht schnell auf, gut für den Kompost |
|
Gekochte Rote Bete |
Achtung |
Zucker → Gärung möglich |
|
Eierkartons (Karton) |
Ja |
Perfekt als Kohlenstoffquelle |
|
Kompostierbarer Kaffee in Kapseln |
Achtung |
Zu überprüfen: OK compost HOME empfohlen |
|
Brauner Karton |
Ja |
Gute Trockenmasse, in kleine Stücke zerreißen |
|
Farbige Kartons |
Nein |
Industrietinten, Rückstandsrisiko |
|
Naturholz-Asche |
Vorsicht, in kleinen Mengen |
Sehr alkalisch, sorgfältig dosieren |
|
Kohlenasche |
Nein |
Enthält Schwermetalle, giftig für den Boden |
|
Pilze |
Ja |
Sehr gute Zersetzungsstoffe |
| Wurstwaren | Nein |
Zu fettig und salzig, zieht Schädlinge an |
|
Haare |
Sehr langsam |
Reich an Keratin, sehr langsamer Abbau |
|
Kohl (Blumenkohl, Rotkohl…) |
Ja |
Geruch möglich, aber kompostierbar |
|
Zitrone |
Ja, in Maßen |
Säurehaltig, zersetzt sich langsam |
|
Rohholzspäne |
Ja |
Langsame, aber nützliche Trockenmasse |
|
Lackierte Holzspäne |
Nein |
Chemische Behandlung |
|
Eierschalen |
Oui, broyées |
Zerkleinern, um zu beschleunigen |
|
Camembert-Krusten |
Nein |
Fett + Gärung |
|
Käsekrusten |
Nein |
Geruchsrisiko, fettig, sehr langsam |
|
Brioche-Krusten |
Achtung |
Zu süß, nur in Maßen genießen |
|
Kresse |
Ja |
Sehr feucht, gut vermischen |
|
Radieschengrün |
Ja | Nimmt Feuchtigkeit auf, ideal |
|
Radieschengrün |
Ja |
Idealer Grünabfall |
|
Karottengrün |
Ja |
Sehr schnell kompostierbar |
|
Eichenblätter |
Achtung |
Säurehaltig, langsame Zersetzung |
|
Lorbeerblätter |
Nein |
Sehr zäh, reich an ätherischen Ölen |
|
Walnussblätter |
Nein |
Enthält Juglon, giftig für Pflanzen |
|
Platanenblätter |
Achtung |
Sehr dick, langsamer Abbau |
|
Verwelkte Blumen |
Ja |
Herkömmliche Grünabfälle |
|
Verarbeitete Blumen (Sträuße) |
Nein |
Pestizide, Farbstoffe, giftig für Mikroorganismen |
|
Beschädigte Himbeeren |
Ja |
Verfallen sehr schnell |
|
Schimmlige Früchte |
Ja |
Ausgezeichneter Stickstoff, Vorsicht bei Samen |
|
Kuchen |
Achtung, sehr fettarm und pflanzlich |
Vermeiden, wenn Sahne/Butter enthalten ist |
|
Frisch gemähter Rasen |
Vorsicht, in kleinen Mengen |
Sehr feucht, schnelle Gärung |
|
Keimlinge |
Achtung |
Keimungsgefahr, wenn nicht eingegraben |
|
Grüne Bohnen |
Ja |
Vollständig kompostierbar |
|
Frittieröl |
Nein |
Erstickt Mikroorganismen |
|
Gekochte Linsen |
Achtung |
Kleine Menge, sehr feucht |
|
Tierstreu (mineralisch) |
Nein |
Nicht biologisch abbaubar, Gefahr durch Schwermetalle |
|
Tierstreu (pflanzlich) |
Achtung, je nach Zusammensetzung |
Ok, wenn ohne Zusatzstoffe und tierische Exkremente |
|
Kaffeesatz |
Ja |
Schnelle Stickstoffzufuhr |
|
Melone (Kerne) |
Ja |
Sehr klein, unauffällig |
|
Papiertaschentücher |
Ja |
Gute Kohlenstoffquelle |
|
Fruchtkerne |
Nein, sehr langsam |
Sehr hart, zersetzt sich erst nach 2–5 Jahren |
|
Zwiebeln |
Ja, einzuschränken |
Enthält natürliche antibakterielle Substanzen |
|
Fingernägel |
Achtung, sehr langsam |
Gleiches Problem wie Haare, biologisch abbaubar, aber langsam |
|
Orangen |
Ja, in Maßen |
Gleiche Vorgehensweise wie bei anderen Zitrusfrüchten |
|
Brot |
Ja |
In kleinen Mengen okay. |
|
Backpapier |
Nein |
Oft silikonisiert |
|
Hochglanzpapier |
Nein |
Kunststofffolie, nicht kompostierbar |
|
Zeitungspapier |
Vorsicht, in kleinen Mengen |
In kleinen Mengen okay. |
|
Farbig bedruckte Papiere |
Achtung |
Möglicherweise giftige Tinte |
|
Wassermelone (Schale) |
Ja |
Sehr feucht, mit Braun ausgleichen |
|
Gekochte Nudeln |
Ja |
Ok, wenn ohne Soße und Fleisch |
|
Zitrusschalen |
Ja |
Bei Säuregehalt zu begrenzen |
|
Kiwi-Schalen |
Ja |
Dünn und biologisch abbaubar |
|
Kartoffelschalen |
Ja |
Gute Zersetzung |
|
Erbsen (Schoten) |
Ja |
Reich an Ballaststoffen, wenn möglich zerkleinern |
|
Duftpapier |
Nein |
Chemischer Geruch, nicht biologisch abbaubar |
|
Sukkulenten |
Ja, mit Vorsicht |
Sehr feucht, langsame Zersetzung |
|
Lauch |
Ja |
Faserige Stiele, in Stücke schneiden |
|
Fisch |
Nein |
Gesundheitsrisiko, Gerüche |
|
Milchprodukte |
Nein |
Geruchs- und Gärungsrisiko |
|
Traube |
Ja |
Sehr gut für Bakterien |
|
Essensreste |
Achtung, wenn Sie Vegetarier sind und wenig Fett essen |
Ok, wenn wenig Fett, versteckt + braun |
|
Gekochter Reis |
Vorsicht, ja, wenn naturbelassen |
In Ordnung, wenn naturbelassen, Soßen vermeiden |
|
Teebeutel (ohne Klammer) |
Ja |
Ohne Heftklammern kompostierbar |
|
Teebeutel (mit Clip) |
Nein |
Enthält Metall, zu trennen |
|
Biokunststoffbeutel EN13432 |
Nein |
Nicht für den Hauskompost geeignet |
|
Kraftbeutel |
Ja, wenn nicht behandelt |
Nicht bedruckt, nur fettfrei |
|
OK compost HOME-Beutel |
Achtung |
Mäßig zuverlässig |
|
Salat (Reste) |
Ja |
Zersetzt sich sehr gut |
|
Sopalin, unparfümiert |
Ja |
Nimmt Feuchtigkeit auf, ideal |
|
Artischockenhalme |
Achtung |
Sehr faserig |
|
Maisstängel |
Nein, sehr langsam |
Faserig, schwer kompostierbar |
|
Sonnenblumenstiele |
Achtung |
Schwer zu zerkleinern, langsame Zersetzung |
|
Tomaten |
Ja |
Vorsicht bei Samen, wenn sie nicht warm sind |
|
Getrockneter Rasenschnitt |
Ja |
Gute Stickstoffquelle |
|
Fleisch |
Nein |
Zu viel Eiweiß zieht Schädlinge an |
|
Naturjoghurt |
Nein |
Milchprodukt, vermeidbar |
|
Kräutertee, lose |
Ja |
Ideal für Feuchtigkeit |
Zu wissen, was man in seinen Kompost geben muss, ist keine einfache Checkliste, sondern bedeutet, ein Ökosystem zu verstehen. Ein Ökosystem aus Mikroorganismen, Kohlenstoff-Stickstoff-Gleichgewicht, Feuchtigkeit und Zeit. Durch die Einhaltung einiger wichtiger Grundsätze (nicht zu viel Fett, kein Plastik, abwechslungsreiche Zugaben) ermöglichen wir diesen kleinen unsichtbaren Zersetzern, unsere Abfälle in eine lebendige Ressource zu verwandeln.
Kompostieren ist nicht nur Sortieren: Es bedeutet, zu lernen, zu beobachten, wie sich Materie entwickelt, vermodert und verwandelt. Es ist eine einfache, aber anspruchsvolle, bescheidene und wirksame Handlung. Und sie beginnt mit einer alltäglichen Frage: „Kann ich das kompostieren?“
Häufig gestellte Fragen:
Was kann man in einen Gartenkomposter geben?
Man kann Küchenabfälle (Schalen, Obst, Gemüse, Kaffeesatz usw.), trockene Materialien (Pappe, Laub) hineinwerfen, aber Milchprodukte, Fleisch, Fisch oder Plastik vermeiden.
Welche Lebensmittel sollten nicht in den Kompost gegeben werden?
Vermeiden Sie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, sehr fettige oder salzige Fertiggerichte und alles, was chemisch behandelt ist oder Plastik enthält (z. B. Teebeutel mit Klammern).
Kann man Zitrusfrüchte in den Kompost geben?
Ja, aber nur in kleinen Mengen. Ihr Säuregehalt kann die Zersetzung verlangsamen und Mikroorganismen stören. Schneiden Sie sie nach Möglichkeit in Stücke.
Was macht man mit Küchenpapier und Papiertaschentüchern?
Wenn sie nicht parfümiert oder gefärbt sind, können Sie sie kompostieren. Sie liefern Kohlenstoff und helfen, die Feuchtigkeit im Kompost auszugleichen.
Sind kompostierbare Beutel (EN13432 oder OK Compost) wirklich kompostierbar?
Einige sind nur unter industriellen Bedingungen kompostierbar. Nur Beutel mit dem Zertifikat OK compost HOME zersetzen sich in einem Hauskompost – und das auch nur langsam.